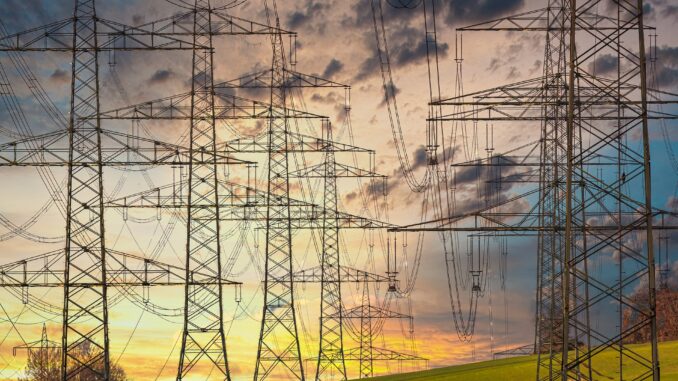
Vergangenen Juni hatte der Bundesrat die Vernehmlassung der Abkommen für die Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU gestartet. Dazu gehört das Abkommen im Bereich Strom zur Stärkung der Versorgungssicherheit und der Netzstabilität sowie der Vereinfachung des Stromhandels. Die Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie SSES hat das Abkommen und die vorgeschlagenen Umsetzungsbestimmungen im Hinblick auf den Ausbau der Solarenergie in der Schweiz untersucht und die Ergebnisse in einem Faktenblatt zusammengefasst, das sie heute veröffentlicht hat.
Die Debatte um die Minimalvergütung für eingespeisten Solarstrom hat gezeigt, dass es beim Stromabkommen und der Umsetzung des Abkommens im Inland noch viele offene Fragen gibt. Die innenpolitische Debatte steht somit am Anfang. Für die SSES im Zentrum stehen dabei mögliche Fortschritte bei der Energiewende und vor allem beim Ausbau der Solarenergie. Trotz der noch offenen Fragen sind aus Sicht der SSES aber bereits heute Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen im Zusammenhang mit dem Stromabkommen von Bedeutung, die in der kommenden Debatte aufgegriffen und adressiert werden müssen. Aus Sicht der SSES zentral sind Planungs- und Investitionssicherheit und somit stabile rechtliche Rahmenbedingungen.
Mögliche Vor- und Nachteile
Aus heutiger Sicht bringt das Stromabkommen verschiedene Chancen und Risiken mit sich. Inwiefern diese eintreffen, hängt von der Entwicklung des Umfelds, etwa der Energiepreise, sowie der Umsetzung ab, die noch Gegenstand der parlamentarischen Debatte ist.
- Im Stromabkommen bekennen sich die Schweiz und die EU, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern und setzen sich als Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien in der Energieversorgung zu erhöhen.
- Weiterhin soll ein Mindestanteil an erneuerbaren Energien in der Grundversorgung gelten, allerdings entfällt die Vorgabe, dass diese aus dem Inland stammen muss. Zudem wird der Anteil der Grundversorgung bedeutend kleiner (alle Kundinnen und Kunden ab 50 MWh Jahresverbrauch müssen in den freien Markt wechseln), wodurch die Vorgaben des Mindestanteils an erneuerbaren Energien weniger bedeutsam wird.
- Die wichtigen Fördermassnahmen Einmalvergütung für Anlagen ab 200 kWp (inkl. Auktionen der Einmalvergütung) und gleitende Marktprämie werden im Abkommen für zehn Jahre abgesichert. Danach muss eine zu schaffende Überwachungsbehörde laufend prüfen, ob die Förderung mit dem EU-Beihilferecht vereinbar ist. Dies schafft eine neue Quelle für Unsicherheit bei Investitionsentscheiden für Solaranlagen. Für Anlagen kleiner 200 kWp ist die Sachlage bzgl. Einmalvergütung noch unklar.
- Die Abnahme- und Vergütungspflicht würde auf 200 kWp beschränkt werden. Grössere Anlagen müssten sich selbst um die Abnahme und Vergütung kümmern und hätten Bilanzkreisverantwortung.
- Ein allenfalls durch die Marktöffnung entstehender Preisdruck könnte mehr Geld für den Ausbau der Erneuerbaren frei machen. Allerdings kann der Preisdruck auch dazu führen, dass inländische Erneuerbare nicht mehr wirtschaftlich genug sind, um die benötigten Investitionen auszulösen.
- Die Schweizer Herkunftsnachweise (HKN) für erneuerbaren Strom werden von der EU wieder anerkannt. Allerdings sind die HKN sind in der Schweiz wie in der EU derzeit praktisch wertlos.
Die Analyse des Abkommens und der Umsetzungsbestimmungen sind zum aktuellen Zeitpunkt zwangsläufig nicht abschliessend. Die SSES wird daher das Faktenblatt im Laufe der anstehenden Debatte anpassen und ergänzen.
Medienkontakt:
Urs Scheuss, Geschäftsleiter SSES, 078 795 91 83, urs.scheuss@sses.ch



